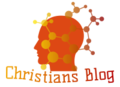Der Problemlösungsprozess beschreibt eine strukturierte Herangehensweise zur Lösung eines Problems. Dabei soll ausgehend von einem IST-Zustand ein SOLL-Zustand erreicht werden. Um eine geeignete, nachhaltige Lösung finden zu können, sollte man zunächst versuchen das Problem zu verstehen.
Ich habe schon oft erlebt, dass man sich sehr früh auf eine vermeintliche Lösung fixiert, ohne überhaupt das tatsächliche Problem näher beleuchtet zu haben. Solche Schnellschüsse bringen dann in komplexeren Domänen oft andere Probleme mit sich oder zeigen keine dauerhafte Wirkung. Ich bin davon überzeugt, dass es die Investition wert ist, ein Problem zunächst einmal zu verstehen, wenn man damit sicherstellt, dass man sich anschließend in die richtige Richtung bewegt.
Erster Schritt: Das Problem verstehen
Haben wir überhaupt ein Problem, das gelöst werden muss? Die Antwort auf diese Frage kann trivial sein, manchmal ist sie es bei näherer Betrachtung aber auch nicht. Ein einfaches Ja ist keine gute Antwort auf diese Frage. Besser ist eine Antwort mit Begründung: Wir haben ein Problem, weil… . Von dieser Begründung sollte man selbst überzeugt sein und sie anderen gegenüber vertreten können.
Mitunter stellt man aber auch fest, dass ein Problem gar nicht gelöst werden muss, wie das folgende Beispiele verdeutlicht.
Im Monitoring eines größeren Software-Systems fällt auf, dass es immer wieder Verbindungsabbrüche bei der Kommunikation mit einem Drittsystem gibt. Eine nähere Analyse zeigt, dass das Drittsystem grundsätzlich instabil ist und man darauf keinen direkten Einfluss nehmen kann. Retry-Mechanismen im eigenen System gewährleisten aber, dass alle Daten zeitnah übertragen werden, denn in der Regel ist der nächste Verbindungsaufbau wieder erfolgreich. Das Drittsystem wird in naher Zukunft abgelöst. Es wird entschieden, dass keine Maßnahmen ergriffen werden.
Was ist der Kern des Problems? Wenn man es mit einer Verkettung von Problemen zu tun hat, kann man sich von den Symptomen rückwärts bis zur Wurzel durcharbeiten. Bei allgemeineren Problemen kann man sich mit gezielten Fragen der Wurzel des Problems nähern. Wenn die Anzahl der Benutzerregistrierungen auf einer neuen Plattform deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, kann man zum Beispiel mit dem Denkansatz an das Problem herangehen: Was muss denn gegeben sein, damit sich ein Benutzer registriert?
Dazu passend ein Zitat, dass Albert Einstein zugeschrieben wird:
Wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten damit verbringen, über das Problem nachzudenken und fünf Minuten über die Lösung.
Zweiter Schritt: Das Ziel formulieren
Was muss geschehen, damit das Problem nicht mehr existiert? Hier geht es darum, das SOLL zu formulieren. Dies ist eine entscheidende Grundlage für den nächsten Schritt. Wenn das Problem als IST-Zustand häufig veraltete Daten am Ende einer Verarbeitungskette sind, dann ist es das Ziel, dass diese Daten regelmäßig aktuell sind.
Dritter Schritt: Lösungsideen generieren
Nachdem die Wurzel des Problems bekannt ist, man sich darüber einig ist, was genau das Problem ist und welcher SOLL-Zustand erreicht werden soll, kann man anfangen Lösungsideen zu generieren. Hierbei können etablierte Methodiken zur Ideengenerierung wie das Brainstorming oder das Brainwriting angewandt werden.
Vierter Schritt: Lösungsvorschlag erarbeiten
Im vierten Schritt können die generierten Lösungsideen bewertet und gegenübergestellt werden und es wird sich für einen Lösungsvorschlag entschieden. Dieser Lösungsvorschlag kann auch verschiedene Lösungsideen vollständig oder in Teilen miteinander kombinieren. Um von den Lösungsideen zu einem Lösungsvorschlag zu kommen, sollte man sich auch die Frage stellen, was einem denn wichtig ist. Hat Qualität den höchsten Stellenwert? Nachhaltigkeit? Eine schnelle Umsetzung? Niedrige Kosten?
Fünfter Schritt: Umsetzung planen und durchführen
Der Lösungsvorschlag wird nun in einzelne Arbeitsschritte und ihre zeitlichen Zusammenhänge heruntergebrochen, die im Anschluss abgearbeitet werden können. Während der Abarbeitung sollte kontinuierlich neu bewertet werden, ob die weitere Umsetzung des Vorgehens noch zum gewünschten SOLL-Zustand führen wird. Ist das nicht mehr gegeben, muss justiert oder im schlimmsten Fall das Vorgehen abgebrochen werden. In diesem Fall kehre man zurück zu Schritt drei.
Sechster Schritt: Bewertung des Ergebnisses und Reflexion
Ist der SOLL-Zustand erreicht? Ist das Problem nachhaltig gelöst? Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Was haben wir im Problemlösungsprozess gelernt und was können wir für die Zukunft mitnehmen?
Kann man die ersten beiden Fragen mit Ja beantworten, so hat man das Problem erfolgreich gelöst. Ist dies nicht der Fall, kehrt man zu Schritt drei zurück. Mit Reflexion verinnerlicht man bewusster, was im Problemlösungsprozess gut und was nicht so gut gelaufen ist, damit man Probleme zukünftig noch besser angehen und die Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren kann.